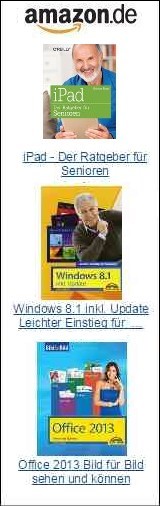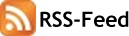Spezielle Geschichte, über die nicht offen gesprochen wird. Wie häufig die Leute zur Toilette müssen, gibt Ärzten Hinweise auf die Darmtätigkeit. Diese wiederum lässt Rückschlüsse auf die Gesundheit des Einzelnen zu. Aber wie oft ist normal? Einmal die Woche "großes Geschäft" – oder "ich kann fünf Mal am Tag auf's Klo". Wo liegt das gesunde Mittelmaß für diese Art des Toilettengangs?
Spezielle Geschichte, über die nicht offen gesprochen wird. Wie häufig die Leute zur Toilette müssen, gibt Ärzten Hinweise auf die Darmtätigkeit. Diese wiederum lässt Rückschlüsse auf die Gesundheit des Einzelnen zu. Aber wie oft ist normal? Einmal die Woche "großes Geschäft" – oder "ich kann fünf Mal am Tag auf's Klo". Wo liegt das gesunde Mittelmaß für diese Art des Toilettengangs?
Anzeige
Nicht das ich jetzt unter die Proktologen gegangen wäre (und die letzte Darmspiegelung liegt auch schon über ein Jahr zurück). Und nein, ich bin auch kein Koprolithen-Forscher geworden. Aber es gibt Leute, die sich mit so etwas beschäftigen – und im Sommer 2024 kam eine Studie Aberrant bowel movement frequencies coincide with increased microbe-derived blood metabolites associated with reduced organ function von US-Forschern heraus.
In der Studie wurde ein Zusammenhang zwischen der Stuhlgangshäufigkeit und der allgemeinen Gesundheit durch Forscher des Institute for Systems Biology (ISB) hergestellt. Die Forscher zeigten, dass Alter, Geschlecht und Body Mass Index (BMI) signifikant mit der Stuhlgangshäufigkeit zusammenhängen.

(Quelle: Pexels/Pixabay CC0 Lizenz)
Die Forschungsergebnisse des Institute for Systems Biology (ISB) legen nahe, dass die Häufigkeit des Stuhlgangs mit der langfristigen Gesundheit zusammenhängt. Ein vom ISB geleitetes Forschungsteam untersuchte für die Studie die klinischen, lebensstilbezogenen und multimikrobiellen Daten von mehr als 1.400 gesunden Erwachsenen. Sie fanden heraus, dass die Häufigkeit des Stuhlgangs einen großen Einfluss auf die Physiologie und die Gesundheit eines Menschen haben kann.
Unter dem Stichwort "Timing ist alles" teilte das Forschungsteam die Probanden über die selbst angegebene Häufigkeit des Stuhlgangs in vier Gruppen ein: Verstopfung (ein oder zwei Stuhlgänge pro Woche), niedrig-normal (zwischen drei und sechs Stuhlgänge pro Woche), hoch-normal (zwischen einem und drei Stuhlgänge pro Tag) und Durchfall.
Nach der Kategorisierung untersuchte das Team den Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Stuhlgangs und Faktoren wie Demografie, Genetik, Darmmikrobiom, Blutmetaboliten und Plasmachemie.
Die Studie zeigte, dass Alter, Geschlecht und Body-Mass-Index (BMI) signifikant mit der Häufigkeit des Stuhlgangs zusammenhängen. Insbesondere jüngere Menschen, Frauen und Menschen mit einem niedrigeren BMI neigten dazu, weniger häufig Stuhlgang zu haben.
Anzeige
"Frühere Forschungen haben gezeigt, dass die Häufigkeit des Stuhlgangs einen großen Einfluss auf die Funktion des Darmökosystems haben kann", sagte Johannes Johnson-Martinez, der Hauptautor der Studie. "Wenn der Stuhl zu lange im Darm verbleibt, verbrauchen die Mikroben alle verfügbaren Ballaststoffe, die sie zu nützlichen kurzkettigen Fettsäuren vergären. Danach schaltet das Ökosystem auf die Fermentation von Proteinen um, bei der verschiedene Toxine entstehen, die in den Blutkreislauf gelangen können".
Die Forscher zeigten auch, dass die mikrobielle Zusammensetzung des Darmmikrobioms der Studienteilnehmer ein verräterisches Zeichen für die Häufigkeit des Stuhlgangs war. Ballaststofffermentierende Darmbakterien, die oft mit Gesundheit in Verbindung gebracht werden, schienen in einer „Goldlöckchen-Zone" der Stuhlgangshäufigkeit zu gedeihen, in der die Menschen zwischen 1 und 2 Mal pro Tag zur Toilette müssen. Bakterien, die mit der Eiweißfermentierung oder dem oberen Magen-Darm-Trakt in Verbindung gebracht werden, waren jedoch bei Personen mit Verstopfung bzw. Durchfall eher angereichert.
Ebenso zeigten mehrere Blutmetaboliten und Plasmachemikalien signifikante Assoziationen mit der Häufigkeit des Stuhlgangs. Das deutet auf mögliche Zusammenhänge zwischen Darmgesundheit und dem Risiko für chronische Krankheiten hin. Insbesondere mikrobiell gewonnene Nebenprodukte der Eiweißfermentation, die bekanntermaßen die Nieren schädigen, wie p-Kresolsulfat und Indoxylsulfat, waren im Blut von Personen mit Verstopfung angereichert, während klinische Chemiewerte, die mit Leberschäden in Verbindung gebracht werden, bei Personen mit Durchfall erhöht waren.
Insbesondere die Blutspiegel von Indoxylsulfat standen in signifikantem Zusammenhang mit einer verminderten Nierenfunktion, was einen ersten Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Stuhlgangs, dem Stoffwechsel des Darmmikrobioms und Organschäden in dieser gesunden Kohorte liefert.
Es überrascht nicht, dass diejenigen, die angaben, sich ballaststoffreich zu ernähren, eine bessere Flüssigkeitszufuhr zu haben und regelmäßig Sport zu treiben, sich eher in der Goldlöckchen-Zone des Stuhlgangs befanden. Irgendwie hat mir der Begriff "Goldlöckchen-Zone des Stuhlgangs" gefallen – den Betriff kannte ich nicht, aber der Rest mit Ernährung, Flüssigkeitszufuhr und Sport passt. Ich wusste es, auf die "inneren Werte" kommt es an.
"Chronische Verstopfung wurde mit neurodegenerativen Erkrankungen und mit dem Fortschreiten chronischer Nierenerkrankungen bei Patienten mit aktiver Erkrankung in Verbindung gebracht", sagte Dr. Sean Gibbons, ISB-Professor und korrespondierender Autor der Studie. "Bisher war jedoch unklar, ob Anomalien der Darmbewegung frühe Triebkräfte für chronische Krankheiten und Organschäden sind oder ob diese retrospektiven Assoziationen bei kranken Patienten lediglich ein Zufall sind.
"Hier zeigen wir in einer im Allgemeinen gesunden Bevölkerung, dass insbesondere Verstopfung mit Blutspiegeln von mikrobiell abgeleiteten Toxinen verbunden ist, die bekanntermaßen Organschäden verursachen, und zwar noch vor einer Krankheitsdiagnose", so Gibbons.
Die Studie untersuchte auch Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit des Stuhlgangs und Angstzuständen und Depressionen, was darauf hindeutet, dass die psychische Gesundheit davon abhängt, wie oft man kackt.
„Insgesamt zeigt diese Studie, wie die Häufigkeit des Stuhlgangs alle Körpersysteme beeinflussen kann und wie eine abweichende Häufigkeit des Stuhlgangs ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung chronischer Krankheiten sein kann", so Gibbons. "Diese Erkenntnisse könnten Strategien zur Steuerung der Stuhlgangshäufigkeit selbst in gesunden Bevölkerungsgruppen liefern, um Gesundheit und Wohlbefinden zu optimieren."
Das Thema ist mir vor einiger Zeit in diesem Focus-Online-Artikel untergekommen, und ich fand es nicht uninteressant.
Anzeige